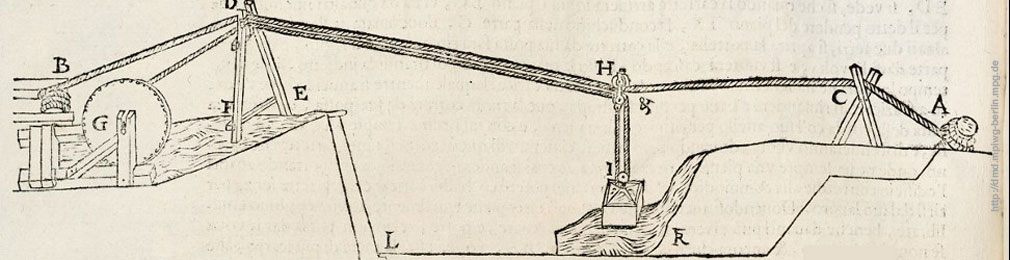Orte der Verknüpfung von Wissenschaft und Technik im 20. Jahrhundert
Veranstalter: Helmuth Trischler, Carsten Reinhardt
Datum, Ort: 16.09.2004, Historikertag Kiel
Bericht von: Ralph Boch, Deutsches Museum München
E-Mail:
Von Seiten der Wissenschafts- und Technikgeschichte näherte sich eine von Helmuth Trischler (Deutsches Museum München) und Carsten Reinhardt (Universität Regensburg) organisierte Sektion dem Motto des 45. Deutschen Historikertages und rückte "Orte der Verknüpfung von Wissenschaft und Technik im 20. Jahrhundert" in den Blickpunkt. Die Vorträge der Sektion referierten dabei Zwischenergebnisse der im Jahr 2000 von der DFG am Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte eingerichteten Forschergruppe "Wechselbeziehungen zwischen Naturwissenschaft und Technik. Formen der Wahrnehmung und Wirkung im 20. Jahrhundert". An die räumlichen Dimensionen solcher Verknüpfungen wurde mit einem ganzen Bündel von Ansätzen herangegangen: Von konkreten Orten, wie der Stadt oder einzelnen Forschungslaboratorien, über Räume der Kooperation und Vernetzung bis hin zu alltagstechnischen Artefakten reichte das Spektrum. So wurde versucht, einen Bogen von geographischen über soziale bis zu kulturellen und symbolischen Elementen von Räumlichkeit zu spannen. In sämtlichen der vorgestellten Fallstudien wurde an oder um die betreffenden Orte und Räume eine verdichtete Kommunikation und Vernetzung sichtbar, deren Wandel in historischer und auch theoretischer Perspektive in den Blick genommen wurde.
Zunächst erinnerte Helmuth Trischler in seiner Einführung daran, dass es gerade Befunde der Wissenschafts- und Technikgeschichte waren, die maßgeblichen Anteil am Verschwinden bzw. der Bagatellisierung des Raumes in zahlreichen wissenschaftlichen Diskursen hatten. Hierzu rechnete er weitreichende Aussagen über Mobilität und Beschleunigung ebenso wie die ort- und raumlose Behandlung von wissenschaftlichem und technischem Wissen. Damit wurd dessen Anspruch auf universelle Geltung und raumunabhängige Sachlichkeit reproduziert und der Blick auf räumliche Dimensionen der Wissenschafts- und Technikentwicklung lange Zeit verstellt. Neuere Forschungen dagegen integrieren "spatial questions" an prominenter Stelle, so dass diese in der Wissenschafts- und Technikgeschichte, laut Trischler, mittlerweile "auf weit geöffnete Türen" treffen. Er nannte Studien zur lokalen, regionalen und nationalen Gebundenheit von Wissen, zum Transfer von Wissenschaft und Technik in Anwendungskontexte und 'benachbarte' gesellschaftliche Räume, Ansätze zur Untersuchung von territorialen Ordnungen von Wissensproduktion und nicht zuletzt Arbeiten, die die Rolle wissenschaftlicher und technischer Praktiken bei der Konstruktion von Räumen und Raumbildern selbst problematisieren. Die in der Sektion vorgestellten Papiere nahmen diese Pluralität auf, hatten ihren gemeinsamen Fokus aber nicht nur in ihrem Raumbezug, sondern auch im gemeinsamen methodischen Rahmen des deutschen-amerikanischen Vergleichs, der die Arbeiten der Münchner DFG-Forschergruppe umspannt.
Martina Heßler (RWTH Aachen) wandte sich zunächst einem Ort zu, den Hubert Laitko einmal die "Grundeinheit der geographischen Bindung von Wissenschaft" genannt hat [1]: die Stadt. Zu dieser hatten wissenschaftliche Institutionen und Akteure seit Jahrhunderten enge, wenn nicht symbiotische Beziehungen. Dieses traditionell starke Verhältnis bildete nach Heßler im historischen Prozess unterschiedliche Topographien aus, in denen sich historisch variable Vorstellungen der Beziehung von Wissenschaft und Gesellschaft sowie von Wissenschaft und Technik materialisierten. An ihrem Beispiel München bzw. dem seit den 1950er Jahren entstandenen, im Norden der Stadt gelegenen Forschungsstandort Garching konnte sie zeigen, wie hier, ähnlich wie in anderen europäischen Städten, das traditionell nahräumliche und stadtzentrale Verhältnis von Wissenschaft und Stadt aufgebrochen wurde, indem Neugründungen und Erweiterungen in der Peripherie des urbanen Raums angesiedelt wurden. Heßler sah darin - neben praktischen Gründen wie der Raumnot der Innenstädte - einen räumlichen Ausdruck zeitgenössischer Wissenschafts- und Gesellschaftsdiskurse, für die Autonomie und Distanz von Forschung im Mittelpunkt standen, was wiederum im funktionalen Paradigma der zeitgenössischen Urbanistik seinen städtebaulichen Rückhalt fand. Weil der Neu- und Ausbauschub von Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen in den 1960er und 1970er Jahren mit einer stürmischen und heroischen Phase des modernen Städtebaus zusammenfiel, lagen weitreichende Neulösungen, wie die Schaffung ganzer Stadtteile und Universitätskomplexe, durchaus im Rahmen des zeitgenössischen Planungshorizonts. Entsprechungen fand diese Distanz schaffende Raumorganisation dann auch in den technisch-wirtschaftlichen Ausgründungen der Garchinger Institute. Auch hier sollte der Kernbereich einer vermeintlich autonomen Produktion wissenschaftlichen Wissens nicht berührt werden, und die Institute wurden personell, institutionell und räumlich von ihren "Mutterinstituten" abgetrennt. Solche, die Dichotomie und Linearität von Innovationsprozessen betonenden Vorstellungen gerieten bei den maßgeblich am Diskurs beteiligten Akteuren im Laufe der 1970er Jahre in Bewegung. Mischformen und die Auflösung starrer Grenzen wurden nicht nur in der Stadtplanung zu wichtigen Schlagwörtern, sondern wirkten bis in die Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik. Man bemühte sich jetzt um eine Reintegration der neuen Wissenschaftskomplexe in den städtischen/dörflichen Raum, um eine Verflechtung der Institutionen, um eine Verflüssigung institutioneller und räumlicher Grenzen. Urbanität als Lebensform, als Praxis dichter Interaktion wurde zum Ideal, das man jetzt im suburbanen Raum, 'auf der grünen Wiese' herzustellen versuchte - ein Unterfangen, das angesichts der Heterogenität, Vielschichtigkeit und vor allem der Handlungsabhängigkeit urbaner Entwicklung nur begrenzte Erfolgsaussichten haben konnte.
In der Diskussion tauchte die Frage nach dem exemplarischen Charakter des Garchinger Beispiels auf. Dieses untermauerte Heßler mit zahlreichen vergleichbaren Fälle wie Berlin-Adlershof oder Zürich. Gleichzeitig wurde auf variierende Entwicklungen und Traditionen hingewiesen: Im deutschen Bereich kam es z.B. bei der Universität Kassel aufgrund spezieller Konstellationen noch einmal zu einer stadtzentralen Lösung, genauso wie die Campustradition des anglo-amerikanischen Raumes andere topographische Ordnungen entstehen ließ. In Kommentaren wurden nach Kontinuitäten und Bezügen der in Garching geschaffenen Institute zum Dahlem der "alten" Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gefragt, wobei auch die von Heßler herausgearbeitete Raumorganisation, insbesondere die so zentrale Betonung von Autonomie, in den Zusammenhang der geschichtspolitischen Reaktionen auf die Verbindung von Wissenschaft und Nationalsozialismus gestellt wurden.
Den urbanen Nahraum von Wissenschaft-Technik-Beziehungen verließ der Vortrag von Michael Eckert (Deutsches Museum München). Eckert richtete den Fokus auf politisch überlagerte Prozesse bilateralen Wissensaustauschs zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten in der Zwischenkriegszeit, die sich in den Worten Eckerts "zwischen Geheimhaltung und wissenschaftlichem Internationalismus" bewegten. Er konnte zeigen, dass in dieser Krisenphase der internationalen Wissenschaftsbeziehungen im militärisch heiklen Feld der Luftfahrtforschung, speziell der Aerodynamik, lange Zeit bemerkenswerte transatlantische Kontakte und Austauschbeziehungen bestanden. So unterhielt das 1915 gegründete amerikanische "National Advisory Committee for Aeronautics" (NACA) ab 1919 ein Büro in Paris, um dort Material und Informationen über die europäische Entwicklung zu sammeln, genauso wie das im Ersten Weltkrieg etablierte Militärattachéwesen bei den Botschaften zusätzliche "intelligence"-Kanäle in diesem Feld eröffnete. Ungeachtet des in zahlreichen Wissenschaftsfeldern praktizierten Boykotts Deutschlands und seiner Verbündeten wurden rege Kontakte zwischen NACA-Vertretern und deutschen Forschungseinrichtungen, insbesondere der Göttinger Aerodynamischen Versuchsanstalt Ludwig Prandtls, gepflegt. Auch der Machtantritt der Nationalsozialisten brachte keine nennenswerten Veränderungen dieses transnationalen Kooperationsraums, allerdings wurde dieser jetzt verstärkt auch zur Beschaffung strategischer Informationen im Zuge der deutschen Aufrüstung genutzt. Parallel dazu existierte ein internationales Kongresswesen im Bereich der angewandten Mechanik, das bis 1938 regelmäßig von deutschen Forschern frequentiert wurde. Der Kriegsausbruch verschüttete dann sämtliche dieser Austauschkanäle. Das NACA-Büro in Europa wurde geschlossen, international besetzte Gremien wie die "Deutsche Akademie der Luftfahrtforschung" begannen sich entlang der Kriegskonstellation zu 'entmischen', und das internationale Kongresswesen kam zum Erliegen.
In der Diskussion tauchten Fragen nach der Vergleichbarkeit dieser deutsch-amerikanischen Beziehungen auf, und Eckert machte deutlich, dass entsprechende Kontakte z.B. zwischen Deutschland und dem benachbarten Frankreich in jenen Jahren undenkbar gewesen wären, mithin die Außenbeziehungen der deutschen Wissenschaften in bilateraler Perspektive zu differenzieren sind. Der Internationalismus der Wissenschaft bildete in der Luftfahrtforschung jener Jahre eine rhetorische Fassade für sehr pragmatische, politisch-militärische Interessen und manifestierte sich wohl am ehesten noch auf der Ebene der Mechanik-Kongresse, neben denen aber jene von Eckert herausgearbeiteten Sonderräume bestanden, denen die Forschung bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat.
Der Vortrag von Carsten Reinhardt (Universität Regenburg) lenkte den Blick dann auf soziale und organisatorische Binnenräume naturwissenschaftlicher Disziplinen. Diese sahen sich im 20. Jahrhundert mit einem stetigen Bedeutungszuwachs immer kostenintensiverer Forschungstechnologien konfrontiert, und Reinhardt fragte nach Strategien und auch räumlichen Veränderungen, die sich bei der Integration dieser Technologien und Apparaturen in verschiedenen Disziplinen beobachten ließen. Die Wissenschaftsforschung hat ähnliche Fragen insbesondere für Teilbereiche der Physik behandelt, die durch Teilchenbeschleuniger und Forschungsreaktoren als zentrale Entwicklungsfelder einer auf Großinstrumente gestützten "big science" gelten. Reinhardt variierte und erweiterte die Perspektive in Richtung der Chemie und der Biologie, in denen die Technisierung bzw. die Durchdringung der Forschungsarbeit mit immer größeren Instrumenten auf andere disziplinäre Traditionen und Organisationsmuster stieß. Dies führte wiederum zu eigenen Adaptionsmustern und räumlich-organisatorischen Lösungen. Reinhardt konnte anhand empirisch gesättigter Fallstudien zur Entwicklung in den Vereinigten Staaten der 1960er bis 1980er Jahre zeigen, wie z.B. in einer stark individualistisch orientierten Chemie die Adaption der meist aus der Physik stammenden Technologien zunächst in speziellen, abgetrennten Serviceabteilungen auf Instituts- und Universitätsebene erfolgte, während in der team- und kooperationsorientierten Biologie früh der Weg regionaler und nationaler Zentrenbildung beschritten wurde. In der Chemie wurde versucht, die neuen Technologien in das bestehende Raum- und Organisationsgefüge der Disziplin einzubauen, die Biologie dagegen bildete schon früh neue, privilegierte Orte aus, was nicht ohne Folgen auf das Hierarchiegefüge der Disziplin bleiben konnte. Doch auch in der Chemie musste man angesichts der Kostenexplosion und der stetigen Nachfrage nach immer leistungsfähigeren Instrumenten den strukturkonservativen Pfad verlassen und sich in den 1970er Jahren umorientieren. Nun begannen interdisziplinäre Großeinrichtungen wie das "Stanford Magnetic Resonance Laboratory" eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Der Einfluss der dort beschäftigten und über die Nutzung entscheidenden Wissenschaftler und Techniker erhöhte sich massiv. Diese konnten ihre und die Position ihrer Einrichtung wiederum nur durch eine fortwährende externe Nachfrage und durch ständige Methodeninnovationen sichern. Reinhardt konnte zeigen, dass sich an diesen neuen Zentren auch neue Muster der Wissensproduktion und -distribution herausbildeten. Die dort beschäftigten Wissenschaftler wurden mehr und mehr zu wichtigen Mittelsmännern an diesen von großer Interaktionsdichte gekennzeichneten "Marktplätzen des Wissens". Der geographische Ort erlebte dadurch einen massiven Bedeutungszuwachs, was sich durch soziale Prestige- und Statuszuschreibungen verstärkte und insofern die topographische Ordnung der Wissensproduktion nachhaltig veränderte.
In der Diskussion wurde der zeithistorische Hintergrund des Kalten Krieges angesprochen, dessen Klima und Dispositionen auch das Wissenschaftssystem tief durchdrangen und beim Technisierungsschub in den Naturwissenschaften eine wichtige Rolle spielten.
Ralph Bochs (Deutsches Museum München) Vortrag war gewissermaßen zwischen den von Reinhardt beschriebenen Orten und den von Eckert thematisierten, weit ausgreifenden Verflechtungen von Wissensproduktion angesiedelt. Er versuchte räumliche Orientierungen der geowissenschaftlichen Forschung im Deutschland des 20. Jahrhunderts zwischen "Lokalität und Globalität" zu verorten. Dazu wählte er den Fall eines einzelnen Wissenschaftsstandortes - den des Telegrafenbergs in Potsdam - und untersuchte aus dieser Perspektive sich wandelnde "Handlungs- und Bezugsräume" von Wissensproduktion. Dieser im Kaiserreich entstandene Ort zeichnete sich in den Jahren bis 1914 durch eine enge Verflechtung und Bindung mit dem benachbarten Berlin sowie ein erstaunliches Maß an transnationalen Bindungen aus. Dies rechtfertigt es nach Boch, seit dem späten 19. Jahrhundert die Existenz von Möglichkeitsräumen der geowissenschaftlichen Wissensproduktion vorauszusetzen, die sich vom Lokalen bis zum Globalen erstreckten. Gleichzeitig betonte er, dass diese Räume von den einzelnen Akteuren und Institutionen z.B. durch Kooperationen oder Expeditionen erst gefüllt werden mussten, was sich insbesondere im transnationalen Raum während der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts als höchst diskontinuierlicher Prozess darstellte. Den Potsdamer Instituten gelang es in den Kaiserreichsjahren zunächst in erstaunlicher und präzedenzloser Weise, Wissensproduktion dicht und geographisch weiträumig zu verflechten. Diese Verflechtungskonstellation veränderte sich nach 1914 infolge der mehrfachen Systemwechsel wiederholt dramatisch, und Boch versuchte daran die große Bedeutung politisch-territorialer Räumlichkeit für die Wissensproduktion im 20. Jahrhundert aufzuzeigen. Dabei betonte er die Anfälligkeit der besonders raumabhängigen Feldwissenschaften, deren Arbeit jeweils unmittelbar von den Prozessen der Öffnung, Schließung und wiederholten Reorientierung betroffen war, von denen der transnationale Handlungsraum der Potsdamer Institute im Zeitraum zwischen den Kaiserreichs- und den DDR-Jahren gekennzeichnet war. Dieser oszillierte zwischen interkontinentaler Zusammenarbeit, kolonialer Expansion, regionaler Orientierung auf den Ostseeraum und schließlich einer Wendung zum sozialistisch beherrschten Staatenraum Osteuropas. Damit korrespondierte der Bedeutungswandel von regionalen, vor allem aber von nationalen Orientierungen im Kontext nationalsozialistischer Autarkiepolitik sowie den notorischen Rohstoffproblemen des ostdeutschen Staates nach 1945.
In der Diskussion rückte vor allem die Kaiserreichszeit mit ihrer Mischung aus kooperativem Internationalismus und kolonialer Expansion in den Mittelpunkt, und Boch betonte, dass diese Parallelität von Seiten der Geowissenschaftler als völlig unproblematisch und komplementär begriffen wurde. Markant war dabei allerdings das unterschiedliche Bild der jeweiligen Untersuchungsräume: Hier die Gebiete der "Culturstaaten" mit ihren dichten Netzen und Datensammlungen, die immer mehr in den Dienst von Staat und Wirtschaft gestellt wurden, dort sozial und kulturell 'leere' Messräume, die die metropolitanen Wissensbestände um Daten aus entlegenen Gebieten anreichern sollten.
Ulrich Wengenroth (Technische Universität München) schließlich nahm sich der modernen Alltagstechnik als einem 'Ort' an, an dem sich Wissenschafts- und Technikverknüpfungen materialisieren, wobei ihm weniger an den konkreten Artefakten und ihren technischen bzw. wissenschaftlichen Anteilen gelegen war, als an den Vermittlungsprozessen, die sich mit ihrem Konsum verbinden. In Alltagstechnik manifestiert sich eine atemberaubende Technisierung und Verwissenschaftlichung moderner Lebenswelten. Andererseits stellt die steigende Komplexität der Technologie an Konsumenten und Nutzer Rationalitäts- und Wissensanforderungen, die in der modernen Welt, z.B. beim Treffen von Kaufentscheidungen, häufig nicht mehr zu bewältigen sind. Dieses in hochtechnisierten Gesellschaften ubiquitäre Wissensgefälle wird auf unterschiedliche Art und Weise rationalisiert, wofür Wengenroth den Begriff der "Rationalitätsfiktionen" verwandte, ein Begriff, mit dem er jenen symbolischen Diskurs bezeichnete, der die Aneignung wissensintensiver Produkte heutzutage vielfach vermittelt. Er sah hier ein Rationalitätsmuster hochentwickelter Gesellschaften am Werk, das technische und wissenschaftliche Inhalte - sowohl auf Produzenten- wie auch auf Konsumentenseite - trivialisiert und dadurch sozial handhabbar macht. Wissenschaftliche und technische Produkteigenschaften werden in "Rationalitätsfiktionen" von Produkt zu Produkt variierend in radikal simplifizierender Weise beschrieben. Diese Muster können zudem historisch und geographisch erheblich variieren, wie Wengenroth an zahlreichen, international vergleichenden Beispielen, so z.B. dem Kauf von Dieselfahrzeugen in den Vereinigten Staaten und Deutschland zeigen konnte. Dieser entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch auseinander, was sich mit der Ökonomie des Dieselmotors und den Nutzungsbedürfnissen allein nicht erklären lässt. Vielmehr entstanden nach Wengenroth auf beiden Seiten des Atlantiks divergierende, als rational anerkannte Bewertungsmuster dieser Motorentechnik: Der westeuropäischen "Rationalitätsfiktion" einer sparsamen und haltbaren Technik stand die amerikanische gegenüber, die Dieselmotoren Attribute wie stinkend, schmutzig und kälteanfällig zuschrieb. Insofern zeigen moderne Gesellschaften erstaunliche Neigung, Rationalitätsvorstellungen veränderten Umständen anzupassen und bei Entscheidungen mehr und mehr soziokulturelle Konsensvorstellungen in den Mittelpunkt zu stellen, bei denen lediglich ein trivialisierender und hochselektiver Verweis auf Technik und Wissenschaft - z.B. auf Wattzahlen einer Hifi-Anlage - benutzt wird. So können sich auf technische Artefakte sehr unterschiedliche Rationalitätsvorstellungen beziehen, und Wengenroth betonte eine Pluralität von Insellösungen, was insgesamt auf eine erstaunliche gesellschaftliche Flexibilität im Umgang mit Technisierung und wissenschaftlich-technischer Rationalität verweist.
In der Diskussion wurde für den Technikkonsum der ersten beiden Drittel des 20. Jahrhundert die Bedeutung anderer kultureller Faktoren höher veranschlagt, worin Wengenroth keinen grundätzlichen Widerspruch zu dem von ihm beschriebenen Modell sah, das in den letzten Jahrzehnten lediglich eine expansive Entwicklung erfahren hätte, die man nicht zuletzt auf fortdauernde Ausbreitung von "Rationalitätsfiktionen" z.B. auf Bereiche wie die Ernährung oder Kosmetik beobachten könne.
Insgesamt bot die Sektion einen breit angelegten Einblick in Arbeits- und Problemfelder der modernen Wissenschafts- und Technikgeschichte und versuchte diese mit Blick auf das Motto der Gesamttagung zu fokussieren. Offensichtlich wurde dabei, dass in der Bandbreite von institutionengeschichtlichen über objektbezogene bis hin zu eher soziologischen Ansätzen Angebote an zahlreiche, spartenübergreifende Diskurse der Geschichtswissenschaft reichlich vorhanden sind. Wissenschafts- und Technikentwicklung wird heute ebenso wie die Verbreitung, die Rezeption und der Konsum ihrer Ergebnisse als ein durch politische, soziale und kulturelle Faktoren ko-konstruierter Prozess aufgefasst: Dass er als solcher wie alle kulturellen Praktiken auch räumliche Dimensionen aufwies, ist eine Tatsache, für die offensichtlich gerade die jüngere Wissenschafts- und Technikgeschichte ein historisch-theoretisches Sensorium ausgebildet hat.
Anmerkung:
[1] Hubert Laitko: Betrachtungen über den Raum der Wissenschaft, in: Horst Kant (Hrsg.): Fixpunkte. Wissenschaft in der Stadt und der Region, Berlin 1996 S.313-340, S.329.