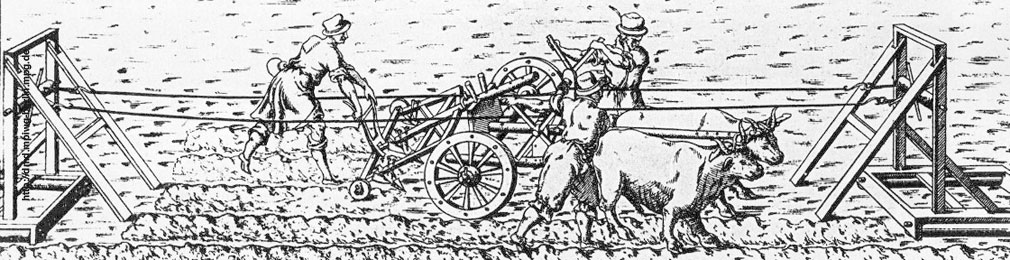Die Entgrenzung von Erwartungshorizonten und die Genese von Gestaltungsöffentlichkeiten
Stefan Böschen
Die Wahrnehmung möglicher Gefährdungen hat sich im Zuge der letzten 100 Jahre dramatisch
verändert. Schien im ausgehenden 19. Jahrhundert die Erwartung an Wissenschaft und Technik
gerechtfertigt, dass sie nicht nur innovativ, sondern auch kurativ tätig sein könne (nämlich auch
die Nebenfolgen von Innovationen bearbeiten zu können), ist dieses Credo im ausgehenden 20.
Jahrhundert deutlich in Frage gestellt. Die Erwartung ist jetzt vielmehr, dass Wissenschaft und
Technik gerade nicht in der Lage sein dürften, die Nebenfolgen von Innovationen in den Griff zu
bekommen. Die Thematisierung des Nichtwissens von Wissenschaft und Technik hat
Konjunktur.
Die Konsequenzen dieses Prozesses sind alles andere als trivial. Denn in der Folge erodieren
bestimmte Voraussetzungen, unter denen bisher Risiken bearbeitet wurden: etwa die sichere
Unterscheidung zwischen Wissen/Nichtwissen, Experten/Laien und damit die Aufgabenteilung
zwischen Wissenschaft und Politik. Vor diesem Hintergrund begreifen sich spätmoderne
Wissensgesellschaften zunehmend als solche der „Selbst-Experimentation“ (Krohn). In der Folge
werden die Rahmenbedingungen von gesellschaftlichen Lernprozessen zum Gegenstand von
gesellschaftlichen und politischen Debatten und Institutionalisierungsprozessen.
Gestaltungsöffentlichkeiten entstehen, um diese Prozesse anzuleiten und die relevanten
Erwartungshorizonte von Gefährdungen herauszupräparieren – jedoch im Wissen um das
Nichtwissen, das mit den jeweiligen Festlegungen unweigerlich verbunden ist und damit nur
vorläufige Entscheidungen zulässt.
Am Beispiel der Entwicklung der Chemiepolitik soll dieses Spannungsverhältnis zwischen
Entgrenzung von Erwartungshorizonten und der Genese von Gestaltungsöffentlichkeiten
empirisch beschrieben und daran anschließend die These erläutert werden, dass diese
Entwicklung spätmodernen Gesellschaften konfliktreiche institutionen- und demokratiepolitische
Herausforderungen beschert.